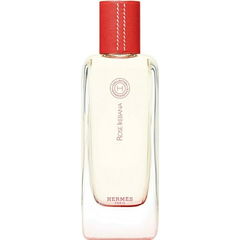Undine
Rezensionen
Filtern & Sortieren
Detailliert
Jenseits der Marketingmärchen: Dunkler Rosensamt für Republikaner
Gewürz mag ich. Grün sowieso. Doch hier zucke ich: Quietschgrün-grasig-würzig-pikant mit leicht säuerlichem Unterton geht es los; die Bergamotte, sonst ja nicht schüchtern, wirkt im Vergleich zur "Hallo-hier-komm'-ich"-Geste des satt dosierten Kardamoms wie ein Mauerblümchen. Ähmm - sollte das nicht was Rosiges werden?! Gemach, gemach, das knallige Grün verzieht sich rasch. Blüten tauchen auf. Im Hintergrund, vage, eine Ahnung von Rose. Aber erstmal drängt sich anderes vor, hell, noch immer leicht mit Säure unterlegt – Jasmin? Möglich. Eindeutig herausriechen kann ich ihn aber nicht; die Aromen sind fein verwoben, vom Anfang bis zum Schluss.
Nach 20 Minuten ist die Rose dann aufgeblüht, groß, dunkel, schwarzroter Samt. Ihr Duft hält, was die Farbe verspricht. Er hat nicht die kompakte, betäubende Süße der (rosa blühenden) Damaszenerrose, die laut Duftpyramide im Flakon steckt. Es ist "Rose-rouge"-Duft (den Begriff hat die Rosenkennerin Alma de l'Aigle geprägt) vom Feinsten, Intensität plus Würze, dabei "verströmend", leicht beweglich, und ein Honighauch spielt mit. Der rosige Farbwandel ist ein Parfümeurskunststück, bewirkt von dezenten Gewürznoten, einer Prise Weihrauch und der anhaltenden Spur von Säure. Nach Stunden hat die Rose unmerklich das Feld geräumt. Immer tiefer und runder ist der Duft derweil geworden, mit warmen, weichen, balsamischen Noten und einem Hauch von Pudrigkeit klingt er langsam aus.
Kräftig dosiert, passt der aparte, eigenwillige, vorzüglich ausbalancierte Duft bestimmt auch zum besonderen (Abend-)Anlass (nicht ausprobiert). Sparsam verwendet, hält er ausgezeichnet und ist gut wahrnehmbar, bleibt dabei jedoch transparent und zart. Und hat keine der Schwächen, die mir Rosendüfte sonst oft verleiden: Er ist kein bisschen seifig, und er ist völlig unsüß, so angenehm knochentrocken wie ein guter, reifer Rotwein. Er steht Jüngeren wie Älteren, taugt für den Alltag und ist trotz seiner traditionell "fülligen" Machart eine schlanke, moderne Erscheinung.
Genau da fängt mein Unbehagen an. Nicht am Duft, oh nein. Sondern an dessen unsäglichem Marketing. Es präsentiert uns diesen Duft als Lieblingsparfum der Königin Marie Antoinette, original aus dem 18. Jahrhundert überliefert. Wer, bitte, soll sowas glauben? Und wer braucht sowas?!? "Duften wie die Königin" – mir Republikanerin stellen sich da die Nackenhaare auf. Erst recht, wenn ich mir vorzustellen versuche, wie die Haute Volée des 18. Jahrhunderts wohl gerochen hat: Puder und Parfum statt Wasser und Seife, Düfte jener Epoche mussten gegen den Mief ungewaschener Leiber anstinken – für heutige Nasen unerträglich. Käuferverdummung. Vermutlich konzipiert für den US-Markt, wo Aristokratisches und "Historisches" prima zieht, Wissen über good ol' Europe aber rar ist. Und um den heimischen Markt wieder zu versöhnen, der den politisch unkorrekten Verweis auf die Vor-Marseillaise-Ära übelnehmen könnte, hat man den Duft mit großem Getöse exakt am Quatorze Juillet herausgebracht. Zum Tag des Bastillesturms, der Marie Antoinettes Herrschaft und Herrlichkeit beendete – für eine Huldigung an diese Königin, die das Parfum ja wohl doch irgendwie sein soll, nicht eben geschmackvoll. Grrrrrr…
Warum ich trotzdem Lust bekam, "Black Jade" zu testen? Irgendwo im WWW las ich, dass Madame la Reine nach Zeitzeugenberichten täglich zu baden pflegte; dann brauchte sie, falls das royale Marketingmärchen wider Erwarten stimmen sollte, also keine zeittypischen Stinkerparfums ;-)).
Quatsch ;-): Neugierig wurde ich durch viele sehr positive Anmerkungen zum Duft. Die kann ich bestätigen. Und werde mir "Black Jade" vielleicht zulegen. Dass ich "nur" mit 80 Prozent bewerte, hat nichts zu tun mit dem Marketingbrimborium, sondern einzig mit dem too much-Auftakt; weniger Kardamom wäre da mehr.
P.S. Auf der Lubin-Website findet man eine sortierte Duftpyramide, die mir recht schlüssig vorkommt:
Kopfnote: Galbanum, Bergamotte, Kardamom
Herznote: Jasmin, Damaszenerrose, Weihrauch, Zimt
Basisnote: Sandelholz, Patchouli, Vanille, Tonkabohne
______
Update 11. März 2012: Nach ausgiebigen Ganztagstests hat sich "Black Jade" nun doch als Nicht-Kaufkandidat erwiesen - die schon angesprochene grün-säuerliche Unternote mag ich nicht täglich in der Nase haben. Gerade diese Note ist aber sehr ausdauernd, heftet sich zudem intensiv an Kleidung... Deshalb auch eine Korrektur bei der Bewertung, auf 70 Prozent.
Nach 20 Minuten ist die Rose dann aufgeblüht, groß, dunkel, schwarzroter Samt. Ihr Duft hält, was die Farbe verspricht. Er hat nicht die kompakte, betäubende Süße der (rosa blühenden) Damaszenerrose, die laut Duftpyramide im Flakon steckt. Es ist "Rose-rouge"-Duft (den Begriff hat die Rosenkennerin Alma de l'Aigle geprägt) vom Feinsten, Intensität plus Würze, dabei "verströmend", leicht beweglich, und ein Honighauch spielt mit. Der rosige Farbwandel ist ein Parfümeurskunststück, bewirkt von dezenten Gewürznoten, einer Prise Weihrauch und der anhaltenden Spur von Säure. Nach Stunden hat die Rose unmerklich das Feld geräumt. Immer tiefer und runder ist der Duft derweil geworden, mit warmen, weichen, balsamischen Noten und einem Hauch von Pudrigkeit klingt er langsam aus.
Kräftig dosiert, passt der aparte, eigenwillige, vorzüglich ausbalancierte Duft bestimmt auch zum besonderen (Abend-)Anlass (nicht ausprobiert). Sparsam verwendet, hält er ausgezeichnet und ist gut wahrnehmbar, bleibt dabei jedoch transparent und zart. Und hat keine der Schwächen, die mir Rosendüfte sonst oft verleiden: Er ist kein bisschen seifig, und er ist völlig unsüß, so angenehm knochentrocken wie ein guter, reifer Rotwein. Er steht Jüngeren wie Älteren, taugt für den Alltag und ist trotz seiner traditionell "fülligen" Machart eine schlanke, moderne Erscheinung.
Genau da fängt mein Unbehagen an. Nicht am Duft, oh nein. Sondern an dessen unsäglichem Marketing. Es präsentiert uns diesen Duft als Lieblingsparfum der Königin Marie Antoinette, original aus dem 18. Jahrhundert überliefert. Wer, bitte, soll sowas glauben? Und wer braucht sowas?!? "Duften wie die Königin" – mir Republikanerin stellen sich da die Nackenhaare auf. Erst recht, wenn ich mir vorzustellen versuche, wie die Haute Volée des 18. Jahrhunderts wohl gerochen hat: Puder und Parfum statt Wasser und Seife, Düfte jener Epoche mussten gegen den Mief ungewaschener Leiber anstinken – für heutige Nasen unerträglich. Käuferverdummung. Vermutlich konzipiert für den US-Markt, wo Aristokratisches und "Historisches" prima zieht, Wissen über good ol' Europe aber rar ist. Und um den heimischen Markt wieder zu versöhnen, der den politisch unkorrekten Verweis auf die Vor-Marseillaise-Ära übelnehmen könnte, hat man den Duft mit großem Getöse exakt am Quatorze Juillet herausgebracht. Zum Tag des Bastillesturms, der Marie Antoinettes Herrschaft und Herrlichkeit beendete – für eine Huldigung an diese Königin, die das Parfum ja wohl doch irgendwie sein soll, nicht eben geschmackvoll. Grrrrrr…
Warum ich trotzdem Lust bekam, "Black Jade" zu testen? Irgendwo im WWW las ich, dass Madame la Reine nach Zeitzeugenberichten täglich zu baden pflegte; dann brauchte sie, falls das royale Marketingmärchen wider Erwarten stimmen sollte, also keine zeittypischen Stinkerparfums ;-)).
Quatsch ;-): Neugierig wurde ich durch viele sehr positive Anmerkungen zum Duft. Die kann ich bestätigen. Und werde mir "Black Jade" vielleicht zulegen. Dass ich "nur" mit 80 Prozent bewerte, hat nichts zu tun mit dem Marketingbrimborium, sondern einzig mit dem too much-Auftakt; weniger Kardamom wäre da mehr.
P.S. Auf der Lubin-Website findet man eine sortierte Duftpyramide, die mir recht schlüssig vorkommt:
Kopfnote: Galbanum, Bergamotte, Kardamom
Herznote: Jasmin, Damaszenerrose, Weihrauch, Zimt
Basisnote: Sandelholz, Patchouli, Vanille, Tonkabohne
______
Update 11. März 2012: Nach ausgiebigen Ganztagstests hat sich "Black Jade" nun doch als Nicht-Kaufkandidat erwiesen - die schon angesprochene grün-säuerliche Unternote mag ich nicht täglich in der Nase haben. Gerade diese Note ist aber sehr ausdauernd, heftet sich zudem intensiv an Kleidung... Deshalb auch eine Korrektur bei der Bewertung, auf 70 Prozent.
3 Antworten
Zeitlos modern, zeitlos schön
Dieser Duft ist traumhaft. Er ist unerhört gut komponiert und trägt seinen Namen zu Recht, denn er "singt" auf der Haut. Er ist leise und macht sich doch aufs Charmanteste bemerkbar. Er hat eine klare stilistische Linie, zwingt aber seiner Trägerin nichts auf, lässt ihr jede Freiheit. Er kommt selbstbewusst daher, zugleich bescheiden; nicht als Monument, sondern mit einem verschmitzten Augenzwinkern – es ist eine "Leute-nehmt-mich-nicht-zu-ernst-ich bin nur-schönste-Nebensache-der-Welt"-Geste dabei.
So weit erstmal. Und wie komme ich jetzt näher dran? Ich versuch's mal so:
Das Andersen-Märchen "Des Kaisers neue Kleider" gehört umgeschrieben. Das kleine Kind, das am Schluss mit seinem Satz "Er hat ja gar nichts an!" die Geschichte wendet, irrt. Es hat Schnupfen. Und so merkt es nicht, dass der Kaiser mitnichten nichts trägt: Duft umgibt ihn als feine, perfekt sitzende Hülle, von Kopf bis Fuß…
Stop. Kein "Es war einmal", das passt nicht. Dieser Duft gehört ins Hier und Heute.
Wobei er natürlich dem Erscheinungsjahr 1962 Tribut zollt: Er ist traditionell gemacht, der Parfumeur hat alle Zutaten-Register gezogen und die Bestandteile so dicht verwoben, dass man kaum Einzelnes herausschnuppern kann. Sozusagen – um im "Gesangs"-Bild zu bleiben – großer sinfonischer Chor. Der bringt Volumen. Und ist ansonsten höchst modern eingesetzt. Verhalten, manchmal nur summend: Nie mehr Aufwand, als nötig ist, um die Idee herauszuarbeiten. Und die ist klar, schnörkellos und knapp gefasst, vom Anfang bis zum Schluss.
Grün. Chypre. Aber geradeaus: kein Zitrus-Tamtam zum Auftakt, frische, blumige und grüne Noten sind sofort innig verschränkt. Das macht den Duft hell und heiter, weich und schmiegsam. Dieser Charakter bleibt. Auch wenn sich im Verlauf viel ändert. So wird die Temperatur immer wärmer. Und die Textur (darf man das von einem Duft sagen?) wird immer samtiger; die wunderbaren Moosnoten des Ausklangs empfinde ich als fast greifbar, als striche man mit den Fingern über dichte Polster am Waldboden. (In der Duftpyramide oben vermisse ich übrigens auch allerhand; ich wette u. a. drauf, dass in der Basis Vetiver mitspielt.)
Zwei Schritte zurück, einen vor, dann begegne ich dem eigenen Duftabbild: Die Aura, die der Duft erzeugt, ist zart, aber präsent. Und sehr beweglich, das leise "Singen" lässt sich immer wieder unverhofft vernehmen, jedesmal ein Lächeln wert. Auch noch beim Einschlafen. Denn dann ist die letzte Duftspur längst noch nicht verflogen, die Haltbarkeit ist phänomenal.
Ich fühle mich erinnert an leichte, fließende Stoffe, Wollgeorgette, Seidencrêpe, Strick, an "Wohnpullover", an Schuhe aus Ziegenleder mit federnden Sohlen; bequem, entspannt, nichts kneift, nichts zwickt. Aber es schlabbert auch nichts. Und bitte Schultern zurück, Kopf hoch – bei aller informellen Lässigkeit, so viel Haltung muss sein :-).
Noch ein Wort zu den 1960ern: In Sachen Design sind sie ein unterschätztes Jahrzehnt. Klassische Moderne, sowas assoziiert man eher mit der Bauhaus-Ära. Aber viele Entwürfe aus den 60ern haben gleiche zeitlos moderne Qualität und sind in Sachen Praxistauglichkeit Bauhaus-Produkten manchmal überlegen. Nur ein Beispiel von vielen (ausgewählt, weil man's bei Interesse leicht googeln kann): "Conseta", Anfang der 60er von Friedrich Wilhelm Möller entworfen, ist ein Sofa in strengen kubischen Formen. Aber der Designer hat nicht "den" Entwurf verfertigt, Copyright-Stempel drauf und gut. Er hat einen Baukasten fabriziert, aus dem man sein Sofa ganz nach Gusto basteln kann; es gibt nicht die eine "richtige" Gestalt, sondern viele.
Im Guerlainschen "Chant d'arômes" finde ich denselben souveränen Umgang mit Design: Hier, Leute, da ist mein Entwurf, nutzt ihn, wie ihr's braucht. Es ist dieselbe unangestrengte, gelassene Modernität. Ebenso wie das Sofa (das gibt es noch!) ist dieser Duft für mich ein moderner Klassiker. Zeitlos. Und zeitlos schön.
So weit erstmal. Und wie komme ich jetzt näher dran? Ich versuch's mal so:
Das Andersen-Märchen "Des Kaisers neue Kleider" gehört umgeschrieben. Das kleine Kind, das am Schluss mit seinem Satz "Er hat ja gar nichts an!" die Geschichte wendet, irrt. Es hat Schnupfen. Und so merkt es nicht, dass der Kaiser mitnichten nichts trägt: Duft umgibt ihn als feine, perfekt sitzende Hülle, von Kopf bis Fuß…
Stop. Kein "Es war einmal", das passt nicht. Dieser Duft gehört ins Hier und Heute.
Wobei er natürlich dem Erscheinungsjahr 1962 Tribut zollt: Er ist traditionell gemacht, der Parfumeur hat alle Zutaten-Register gezogen und die Bestandteile so dicht verwoben, dass man kaum Einzelnes herausschnuppern kann. Sozusagen – um im "Gesangs"-Bild zu bleiben – großer sinfonischer Chor. Der bringt Volumen. Und ist ansonsten höchst modern eingesetzt. Verhalten, manchmal nur summend: Nie mehr Aufwand, als nötig ist, um die Idee herauszuarbeiten. Und die ist klar, schnörkellos und knapp gefasst, vom Anfang bis zum Schluss.
Grün. Chypre. Aber geradeaus: kein Zitrus-Tamtam zum Auftakt, frische, blumige und grüne Noten sind sofort innig verschränkt. Das macht den Duft hell und heiter, weich und schmiegsam. Dieser Charakter bleibt. Auch wenn sich im Verlauf viel ändert. So wird die Temperatur immer wärmer. Und die Textur (darf man das von einem Duft sagen?) wird immer samtiger; die wunderbaren Moosnoten des Ausklangs empfinde ich als fast greifbar, als striche man mit den Fingern über dichte Polster am Waldboden. (In der Duftpyramide oben vermisse ich übrigens auch allerhand; ich wette u. a. drauf, dass in der Basis Vetiver mitspielt.)
Zwei Schritte zurück, einen vor, dann begegne ich dem eigenen Duftabbild: Die Aura, die der Duft erzeugt, ist zart, aber präsent. Und sehr beweglich, das leise "Singen" lässt sich immer wieder unverhofft vernehmen, jedesmal ein Lächeln wert. Auch noch beim Einschlafen. Denn dann ist die letzte Duftspur längst noch nicht verflogen, die Haltbarkeit ist phänomenal.
Ich fühle mich erinnert an leichte, fließende Stoffe, Wollgeorgette, Seidencrêpe, Strick, an "Wohnpullover", an Schuhe aus Ziegenleder mit federnden Sohlen; bequem, entspannt, nichts kneift, nichts zwickt. Aber es schlabbert auch nichts. Und bitte Schultern zurück, Kopf hoch – bei aller informellen Lässigkeit, so viel Haltung muss sein :-).
Noch ein Wort zu den 1960ern: In Sachen Design sind sie ein unterschätztes Jahrzehnt. Klassische Moderne, sowas assoziiert man eher mit der Bauhaus-Ära. Aber viele Entwürfe aus den 60ern haben gleiche zeitlos moderne Qualität und sind in Sachen Praxistauglichkeit Bauhaus-Produkten manchmal überlegen. Nur ein Beispiel von vielen (ausgewählt, weil man's bei Interesse leicht googeln kann): "Conseta", Anfang der 60er von Friedrich Wilhelm Möller entworfen, ist ein Sofa in strengen kubischen Formen. Aber der Designer hat nicht "den" Entwurf verfertigt, Copyright-Stempel drauf und gut. Er hat einen Baukasten fabriziert, aus dem man sein Sofa ganz nach Gusto basteln kann; es gibt nicht die eine "richtige" Gestalt, sondern viele.
Im Guerlainschen "Chant d'arômes" finde ich denselben souveränen Umgang mit Design: Hier, Leute, da ist mein Entwurf, nutzt ihn, wie ihr's braucht. Es ist dieselbe unangestrengte, gelassene Modernität. Ebenso wie das Sofa (das gibt es noch!) ist dieser Duft für mich ein moderner Klassiker. Zeitlos. Und zeitlos schön.
6 Antworten
Hartnäckiger Gruß aus dem Chemielabor
Das Konzept fasziniert mich. Minimalismus, Purismus: wenige Zutaten, die dann auch charakteristisch und rein hervortreten. Klares, schlankes Design, bei dem es nichts Überflüssiges gibt, keine Schnörkel; Konstruktion und Ästhetik sind eins. Für Um- oder Verhüllung ist kein Platz, für Üppigkeit schon gar nicht.
Das folgt, wenn man so will, Bauhaus-Maximen, "form follows function". Aber passt das eigentlich auf Parfümerie? Braucht die nicht hie und da Verhüllungen, aus funktionalen Gründen (z. B. um einem Stoff, der zum Fixieren nötig ist, unerwünschte Duft-Dominanz zu nehmen)? Ist Üppigkeit nicht ein nützliches – vielleicht sogar unentbehrliches – handwerkliches Mittel, um Ingredienzien, die extreme Effekte provozieren können, auszubalancieren und im Zaum zu halten? Und vor allem: Was ist denn "Funktion" und was "Form" eines Dufts, lassen die sich überhaupt trennen?
Fragen über Fragen. Sie drängen sich mir auf, nachdem ich mit fünf von sechs Düften des Minimalisten Jean-Claude Ellena Nieten gezogen habe. (Nr. 6, "Eau Parfumée au Thé Vert Extrème", war ein Volltreffer.) Zu den Nieten zählt leider auch "L‘Eau d’Hiver": Das von meinen Vorschreibern hoch gelobte Wässerchen funktioniert für mich nicht. Und es ist nicht nur ein bisschen daneben, sondern ein Totalflop.
Heu? Heliotrop? Moschus? Honig? Nichts davon nehme ich wahr. Genauer: Zu diesen Wahrnehmungen komme ich gar nicht. Das Winterwasser fängt bei mir schon an mit Noten, die ich als – ich kann es leider nicht präziser ausdrücken – "hohl" empfinde, eigenartig substanzlos, ein bisschen künstlich. Und bald mischt sich etwas ein, das gewürzig-anisartig, leicht süßlich und ganz und gar synthetisch riecht (ich kenne Anisaldehyd nicht, denke nach Ronins Analyse aber, dass es das sein müsste). Dieses Zeuchs überrollt alles andere, was im Flakon steckt. Duftentwicklung findet fortan nicht mehr statt, Duftbewegung auch nicht; starr und statisch hockt der Chemiekram auf meinem Arm, gleichbleibend intensiv, zunehmend nervig.
Nach sechs Stunden hatte ich genug. Es war dann aber mühsam, das Ganze wieder loszuwerden, das Anisaldehyd(?)-Aroma klebte wie Pech.
Ein paar laienhafte Überlegungen:
- Es scheint, als sei hier ein einzelner Parfumbestandteil auf meiner Haut regelrecht durchgeknallt. (Ähnlich lief es auch bei meinen übrigen Ellena-Flops.) Könnte ein anderes, weniger puristisches Duftdesign – mit zähmenden, ausgleichenden Beigaben, also mit mehr Opulenz – dieses extreme Ausbüxen womöglich verhindern? Andersherum: Kann es sein, dass Minimalismus das Flop-Risiko steigert, nach dem Motto: Wenn dabei was schiefgeht, dann gründlich?
- Jedes Mal waren es synthetisch riechende Stoffe, die sich selbstständig gemacht haben. Kann es sein, dass minimalistisches Duftdesign eher zum Griff in die Chemiekiste animiert?
Wie dem auch sei – ich halte mich beim Testen jetzt erstmal an nicht-minimalistische Düfte. Auch wenn Konzepte was haben.
Das folgt, wenn man so will, Bauhaus-Maximen, "form follows function". Aber passt das eigentlich auf Parfümerie? Braucht die nicht hie und da Verhüllungen, aus funktionalen Gründen (z. B. um einem Stoff, der zum Fixieren nötig ist, unerwünschte Duft-Dominanz zu nehmen)? Ist Üppigkeit nicht ein nützliches – vielleicht sogar unentbehrliches – handwerkliches Mittel, um Ingredienzien, die extreme Effekte provozieren können, auszubalancieren und im Zaum zu halten? Und vor allem: Was ist denn "Funktion" und was "Form" eines Dufts, lassen die sich überhaupt trennen?
Fragen über Fragen. Sie drängen sich mir auf, nachdem ich mit fünf von sechs Düften des Minimalisten Jean-Claude Ellena Nieten gezogen habe. (Nr. 6, "Eau Parfumée au Thé Vert Extrème", war ein Volltreffer.) Zu den Nieten zählt leider auch "L‘Eau d’Hiver": Das von meinen Vorschreibern hoch gelobte Wässerchen funktioniert für mich nicht. Und es ist nicht nur ein bisschen daneben, sondern ein Totalflop.
Heu? Heliotrop? Moschus? Honig? Nichts davon nehme ich wahr. Genauer: Zu diesen Wahrnehmungen komme ich gar nicht. Das Winterwasser fängt bei mir schon an mit Noten, die ich als – ich kann es leider nicht präziser ausdrücken – "hohl" empfinde, eigenartig substanzlos, ein bisschen künstlich. Und bald mischt sich etwas ein, das gewürzig-anisartig, leicht süßlich und ganz und gar synthetisch riecht (ich kenne Anisaldehyd nicht, denke nach Ronins Analyse aber, dass es das sein müsste). Dieses Zeuchs überrollt alles andere, was im Flakon steckt. Duftentwicklung findet fortan nicht mehr statt, Duftbewegung auch nicht; starr und statisch hockt der Chemiekram auf meinem Arm, gleichbleibend intensiv, zunehmend nervig.
Nach sechs Stunden hatte ich genug. Es war dann aber mühsam, das Ganze wieder loszuwerden, das Anisaldehyd(?)-Aroma klebte wie Pech.
Ein paar laienhafte Überlegungen:
- Es scheint, als sei hier ein einzelner Parfumbestandteil auf meiner Haut regelrecht durchgeknallt. (Ähnlich lief es auch bei meinen übrigen Ellena-Flops.) Könnte ein anderes, weniger puristisches Duftdesign – mit zähmenden, ausgleichenden Beigaben, also mit mehr Opulenz – dieses extreme Ausbüxen womöglich verhindern? Andersherum: Kann es sein, dass Minimalismus das Flop-Risiko steigert, nach dem Motto: Wenn dabei was schiefgeht, dann gründlich?
- Jedes Mal waren es synthetisch riechende Stoffe, die sich selbstständig gemacht haben. Kann es sein, dass minimalistisches Duftdesign eher zum Griff in die Chemiekiste animiert?
Wie dem auch sei – ich halte mich beim Testen jetzt erstmal an nicht-minimalistische Düfte. Auch wenn Konzepte was haben.
4 Antworten
Die perfekte Orange, sonst (fast) nichts
Diese Orange! Sie ist nicht von dieser Welt.
Sie braucht ein Weilchen, bis sie sich aus dem diffus säuerlichen Auftakt herausgelöst hat. Aber dann gewinnt sie Kontur, so mild, klar und rein, wie ich noch nie eine Orange gerochen habe. Solchen Duft verströmen noch nicht mal reife Früchte direkt vom Baum. Nein, das hier ist keine Fundsache; den Unwägbarkeiten und Unzuverlässigkeiten der Natur hat der Parfumeur nicht getraut. Er wollte Vollkommenheit. Und hat sie geschaffen: die perfekte Orange – aus der Retorte.
Mag ich das riechen? Ja, durchaus.
Mag ich so riechen? Lieber nicht. Höchstens eine Kopfnotenlänge lang.
Dieser Duft, so zeigt sich freilich, hat einen großen Kopf. Einen riesigen. Da steht sie, die perfekte Orange, ein glatt gebügelter Mond, der nicht untergeht. Zwei Stunden, drei, vier. Na gut, ist ja auch ein Kunstmond. Ein Theatermond. Aber warum ist er so lange solo auf der Bühne, wenn das Stück doch "Osmanthe Yunnan" heißt? Eine exzentrische Regie verwehrt der Hauptperson den Auftritt – das Publikum grummelt.
Nach fast sechs Stunden lässt sich Osmanthus, der Hauptdarsteller, endlich blicken. Der Zuschauerraum ist da schon leer (so lange dauert selbst Wagners "Parsifal" nicht, das wohl längste aller langen Bühnenwerke ;-)…). Ist auch besser so, denn dem Hauptdarsteller hat das lange Warten die Stimme verschlagen; sein Auftritt ist jetzt ausdrucksschwach.
Ach ja, fast vergessen: Etwas Teeflüstern war während des Mondsolos auch dabei. Passend dazu habe ich mir nachmittags Pai Mu Tan aufgebrüht, "weißen" Tee, so genannt, weil der würzige Aufguss fast farblos ist ;-)…
Bleibt die perfekte Orange. Nicht von dieser Welt. Aber um dieses Kunst-Stück ging es mir nicht.
Sie braucht ein Weilchen, bis sie sich aus dem diffus säuerlichen Auftakt herausgelöst hat. Aber dann gewinnt sie Kontur, so mild, klar und rein, wie ich noch nie eine Orange gerochen habe. Solchen Duft verströmen noch nicht mal reife Früchte direkt vom Baum. Nein, das hier ist keine Fundsache; den Unwägbarkeiten und Unzuverlässigkeiten der Natur hat der Parfumeur nicht getraut. Er wollte Vollkommenheit. Und hat sie geschaffen: die perfekte Orange – aus der Retorte.
Mag ich das riechen? Ja, durchaus.
Mag ich so riechen? Lieber nicht. Höchstens eine Kopfnotenlänge lang.
Dieser Duft, so zeigt sich freilich, hat einen großen Kopf. Einen riesigen. Da steht sie, die perfekte Orange, ein glatt gebügelter Mond, der nicht untergeht. Zwei Stunden, drei, vier. Na gut, ist ja auch ein Kunstmond. Ein Theatermond. Aber warum ist er so lange solo auf der Bühne, wenn das Stück doch "Osmanthe Yunnan" heißt? Eine exzentrische Regie verwehrt der Hauptperson den Auftritt – das Publikum grummelt.
Nach fast sechs Stunden lässt sich Osmanthus, der Hauptdarsteller, endlich blicken. Der Zuschauerraum ist da schon leer (so lange dauert selbst Wagners "Parsifal" nicht, das wohl längste aller langen Bühnenwerke ;-)…). Ist auch besser so, denn dem Hauptdarsteller hat das lange Warten die Stimme verschlagen; sein Auftritt ist jetzt ausdrucksschwach.
Ach ja, fast vergessen: Etwas Teeflüstern war während des Mondsolos auch dabei. Passend dazu habe ich mir nachmittags Pai Mu Tan aufgebrüht, "weißen" Tee, so genannt, weil der würzige Aufguss fast farblos ist ;-)…
Bleibt die perfekte Orange. Nicht von dieser Welt. Aber um dieses Kunst-Stück ging es mir nicht.
1 Antwort
Nur die Harten kommen in den Garten
Rosen zählen zu meinen Lieblingspflanzen, eine reichliche Hundertschaft von Arten und Sorten wächst in meinem Garten. Fast alle duftend – so unterschiedlich, wie verschiedene Rosen das eben tun. Und im Juni/ Juli, während der Hauptblüte, stehe ich Nicht-Morgenmensch gern ein Stündchen früher auf als nötig, damit ich vor der Arbeit noch eine Schnupperrunde durch den Garten drehen kann.
Vielleicht gerade weil ich Rosen liebe, bringe ich Rosenparfums Skepsis entgegen. Mir ist noch keins begegnet, das mithalten könnte mit dem Duft lebendiger Blüten; zu schwer, zu süß, zu seifig, irgendwas war immer. Jean-Claude Ellenas "Rose Ikebana", so hoffte ich nach euren Schilderungen, könnte das ändern.
Um es vorwegzunehmen: Meine Skepsis ist geblieben. "Anders" war das Dufterlebnis aber tatsächlich ;-)…
Am Anfang ist eine Rose. Nicht die fröhliche gelbe aus euren Beschreibungen. Sondern eine, deren Farbe Rosenfreunde "morbid" nennen würden: Die Blüte hat ein mattes, fahles Bläulichpurpurrosa-Mauve. Sie hat ihren Zenit schon überschritten, ihre Blütenblätter sind verblasst und rollen die Ränder, morgen wird sie entblättert sein. Und wie es bei vergehenden Rosenblüten vorkommt, trifft ein Hauch von Rotwein die Nase.
Etwa ein Stündchen duftet die müde Rose vor sich hin, dann zieht sie sich langsam zurück. Offenbar ins Chemielabor, zehn, 15 Minuten lang rieche ich nur Synthetik-Kuddelmuddel – kriegt die Rose eine Verjüngungskur? Erstmal bleibt sie verschwunden. Aus dem Durcheinander tritt schrittweise Fruchtiges hervor. Sehr frisch, sehr grün, ziemlich sauer: Orangen und Zitronen sind noch längst nicht reif, auch rote und/ oder weiße Johannisbeeren (? – schwarze sind jedenfalls nicht dabei), Pfirsiche (?), Aprikosen (?) wurden weit vor der Zeit gepflückt. Als Apfel ist der quietschgrüne Granny Smith aus dem Supermarkt drin. Und Rhabarber wird - kulinarische Todsünde ;-) - halbroh, ohne Zucker und ohne Vanillesoße serviert. Dafür enthält das Obstkompott das eine oder andere Gewürz. Eigenwillig. Immerhin nicht unangenehm.
Nur: Wo bleibt die Rose?
Sie macht sich erst gut vier Stunden nach ihrem Abtauchen wieder bemerkbar. Da hat sich der Duft bereits dicht an die Haut zurückgezogen. Ein Stündchen lang kann ich die schüchterne Rose noch wahrnehmen, dann bleibt nur noch ein undefinierbarer Hauch.
Zum viel zu leisen Finale hat die Rose die Farbe gewandelt, sie ist nun tatsächlich gelb mit Apricot-Schimmer. Anders als ihre bulgarischen Schwestern, die kraftvoll und großzügig Duft verströmen, gibt sie ihr feines, aber schwaches Aroma erst bei direkter Annäherung preis. Die Blütchen nicken an dünnen Stengeln, das ganze Gewächs wirkt fragil: eine Teerose. Und zwar eine dieser Super-Empfindlichen, die gepäppelt, gehätschelt und vorm Winter am liebsten eingepackt werden wollen.
Nee, da spiele ich nicht mit: Nur die Harten kommen in den Garten!
Von Rosen, die mucken und zicken, nehme ich ohne Bedauern Abschied.
Von Düften, die bei mir nicht funktionieren, auch.
Vielleicht gerade weil ich Rosen liebe, bringe ich Rosenparfums Skepsis entgegen. Mir ist noch keins begegnet, das mithalten könnte mit dem Duft lebendiger Blüten; zu schwer, zu süß, zu seifig, irgendwas war immer. Jean-Claude Ellenas "Rose Ikebana", so hoffte ich nach euren Schilderungen, könnte das ändern.
Um es vorwegzunehmen: Meine Skepsis ist geblieben. "Anders" war das Dufterlebnis aber tatsächlich ;-)…
Am Anfang ist eine Rose. Nicht die fröhliche gelbe aus euren Beschreibungen. Sondern eine, deren Farbe Rosenfreunde "morbid" nennen würden: Die Blüte hat ein mattes, fahles Bläulichpurpurrosa-Mauve. Sie hat ihren Zenit schon überschritten, ihre Blütenblätter sind verblasst und rollen die Ränder, morgen wird sie entblättert sein. Und wie es bei vergehenden Rosenblüten vorkommt, trifft ein Hauch von Rotwein die Nase.
Etwa ein Stündchen duftet die müde Rose vor sich hin, dann zieht sie sich langsam zurück. Offenbar ins Chemielabor, zehn, 15 Minuten lang rieche ich nur Synthetik-Kuddelmuddel – kriegt die Rose eine Verjüngungskur? Erstmal bleibt sie verschwunden. Aus dem Durcheinander tritt schrittweise Fruchtiges hervor. Sehr frisch, sehr grün, ziemlich sauer: Orangen und Zitronen sind noch längst nicht reif, auch rote und/ oder weiße Johannisbeeren (? – schwarze sind jedenfalls nicht dabei), Pfirsiche (?), Aprikosen (?) wurden weit vor der Zeit gepflückt. Als Apfel ist der quietschgrüne Granny Smith aus dem Supermarkt drin. Und Rhabarber wird - kulinarische Todsünde ;-) - halbroh, ohne Zucker und ohne Vanillesoße serviert. Dafür enthält das Obstkompott das eine oder andere Gewürz. Eigenwillig. Immerhin nicht unangenehm.
Nur: Wo bleibt die Rose?
Sie macht sich erst gut vier Stunden nach ihrem Abtauchen wieder bemerkbar. Da hat sich der Duft bereits dicht an die Haut zurückgezogen. Ein Stündchen lang kann ich die schüchterne Rose noch wahrnehmen, dann bleibt nur noch ein undefinierbarer Hauch.
Zum viel zu leisen Finale hat die Rose die Farbe gewandelt, sie ist nun tatsächlich gelb mit Apricot-Schimmer. Anders als ihre bulgarischen Schwestern, die kraftvoll und großzügig Duft verströmen, gibt sie ihr feines, aber schwaches Aroma erst bei direkter Annäherung preis. Die Blütchen nicken an dünnen Stengeln, das ganze Gewächs wirkt fragil: eine Teerose. Und zwar eine dieser Super-Empfindlichen, die gepäppelt, gehätschelt und vorm Winter am liebsten eingepackt werden wollen.
Nee, da spiele ich nicht mit: Nur die Harten kommen in den Garten!
Von Rosen, die mucken und zicken, nehme ich ohne Bedauern Abschied.
Von Düften, die bei mir nicht funktionieren, auch.
6 Antworten